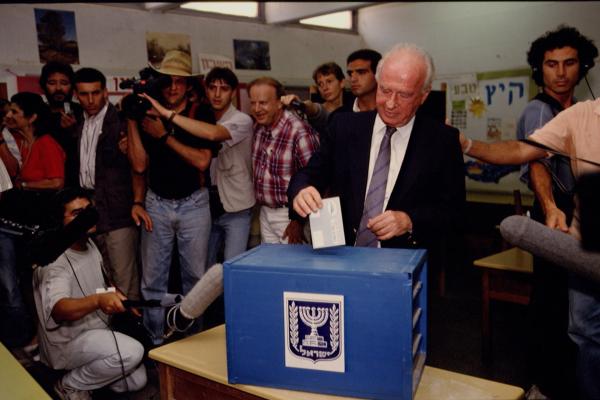Israel und Palästina - Frieden unmöglich?
Zwischen Hass und Hoffnung
Folge 2
Jitzhak Rabin gewinnt im Jahr 1992 die Wahlen und ebnet den Weg für Friedensverhandlungen mit den Palästinensern.
Bildauswahl:

Jitzhak Rabin gewinnt im Jahr 1992 die Wahlen und ebnet den Weg für Friedensverhandlungen mit den Palästinensern.

Unter der Vermittlung von US-Präsident Bill Clinton (M.) reichen sich der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin (l.) und PLO Chef Yasir Arafat (r.) am 13. September 1993 die Hand. Die Unterzeichnung des Oslo-Abkommens ist ein Zeichen der Hoffnung für Frieden im Nahen Osten.

Ein historischer Schritt, der Hoffnung weckt: Im Jahr 1993 unterzeichnen Jitzhak Rabin, Israels Ministerpräsident, und Jassir Arafat, Chef der PLO, das Oslo-Abkommen.

Unter der Vermittlung von US-Präsident Bill Clinton (M.) reichen sich der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin (l.) und PLO Chef Yasir Arafat (r.) am 13. September 1993 die Hand. Die Unterzeichnung des Oslo-Abkommens ist ein Zeichen der Hoffnung für Frieden im Nahen Osten.
Themen
Details
Hinweis
Personen
| von: | Charles Enderlin |
1 weiterer Sendetermin
| Sender | Datum | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|
| ZDFinfokanal | Fr 14.11. | 10:00 | Israel und Palästina - Frieden unmöglich? Zwischen Hass und Hoffnung | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
- in Kalender eintragen
in Kalender eintragen
-
Sendung eintragen in:
Kalender
Google Kalender
-
-
Sendung hinzufügen
zum Merkzettel hinzufügen
-
+ Sendung als TV-Agent einrichten
als TV-Agent einrichten
-
Freunde per Email informieren
per Email informieren
-
in Website einbetten
- 1 weiterer Sendetermin
weitere Sendetermine